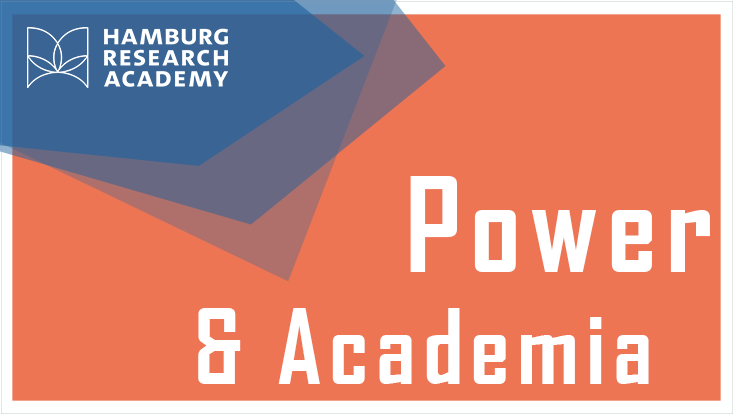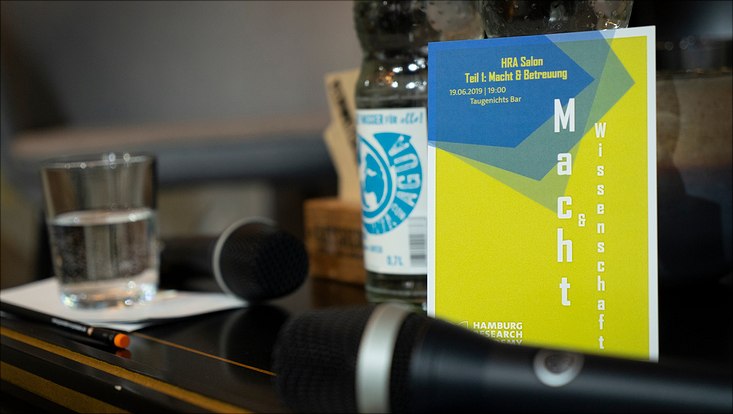Deutsche Besonderheiten: späte Eigenständigkeit und doppelte Abhängigkeiten
Die eingeladenen Expertinnen und Experten aus Deutschland und Großbritannien waren sich sowohl über die Vorteile des deutschen Systems im internationalen Vergleich (Finanzierungslage und Forschungstradition) einig als auch über die größten deutschen Probleme: die lange Promotions- und Postdoc-Phasen, die damit verbundene späte Eigenständigkeit und die daraus resultierenden Abhängigkeitsverhältnisse. Welche Folgen diese Aussichten auf individuelle Karriereverläufe haben können, schilderte Antonia Weberling. Nach dem Studium in Deutschland entschied sie sich bewusst für die Promotion in Großbritannien, wo diese Phase auf vier Jahre begrenzt und eine durchgehende Finanzierung gesichert ist. Die unsicheren Karriereoptionen in Deutschland wirken sich im Kleinen auf einzelne berufliche Entscheidungen und im Großen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Deutschland aus. Darüber hinaus ist es gerade die langjährige Abhängigkeit zu Vorgesetzten, Betreuenden und Begutachtenden – als deutsche Besonderheit sind diese Rollen oftmals in einer Person vereint –, die zu einem starken Machtgefälle führen kann und Machtmissbrauch begünstigt.
Tenure-Track: Ist ein neuer Karriereweg die Lösung?
Klarere Karrierewege und eine frühere Eigenständigkeit auf dem Weg zur Professur waren die Ideen hinter der der Einführung von W1-/Juniorprofessuren, Nachwuchsgruppenleitungen und vor allem Tenure-Track-Professuren. Die Tenure-Track-Professur wurde 2017 gemeinsam von Bund und Ländern eingeführt: Eine Milliarde Euro wurde für 1000 zusätzliche Tenure-Track-Professuren bis 2035 bereitgestellt. Anders als bei der befristeten Juniorprofessur, ist nach einer erfolgreichen Bewährungsphase der Übergang zu einer dauerhaften Professur an der gleichen Universität vorgesehen. Die Förderung sollte die Anzahl der Professuren insgesamt steigern. Durch ausgezeichnete Bewerbungen aus dem In- und Ausland hätten die neuen Stellen dem deutschen Wissenschaftssystem kurzfristig einen spürbaren Aufwind gegeben, so Prof. Dr. Reinhard Jahn, der selbst Teil des Auswahlkomitees der Tenure-Track-Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) war. Auch wenn die neuen Stelleninhaberinnen und -inhaber von den transparenteren Karrierewegen profitieren, wurde leider das Ziel der zusätzlichen Professuren verfehlt: Da der Bund nur die ersten sechs Jahre fördert und die Universitäten die anschließenden Dauerprofessuren selbst finanzieren müssen, wurden überwiegend vorgezogene Neuberufungen vollzogen und damit Tenure-Track-Stellen ausgeschrieben, die ohnehin demnächst, auf Grund der Emeritierung der Stelleninhabenden, freigeworden wären. Aus seiner internationalen Perspektive unterstrich Prof. Dr. David Bogle die grundsätzlich gute Idee der neuen, viel transparenteren und somit attraktiveren Karrierewege. Nun müsse aber nach Wegen gesucht werden, um die Tenure-Track-Stellen langfristig im System zu etablieren.
Tiefliegendes Problem: Zwei gegenläufige Karrieresysteme
Das WissZeitVG steht im Rahmen der #ichbinhanna-Debatte aktuell stark im Scheinwerferlicht. Im HRA Salon wurden die Problematiken zwar angesprochen, doch das Gesetz an sich eher als Symptom und nicht als Ursache bewertet. Dr. Henrike Hartmann und Prof. Dr. Reinhard Jahn waren sich einig, dass das zugrundeliegende Problem vielmehr die parallele Förderung zweier diametraler Systeme sei: Zeitgleich zur Einführung neuer Karrierewege (W1-, bzw. Tenure-Track-Professur mit früherer Eigenständigkeit) werden im Rahmen der Exzellenzstrategie in erster Linie Postdoc-Stellen gefördert, wodurch die herkömmlichen Berufungsverfahren und die damit verbundenen längeren Machtungleichheiten gefestigt werden. Hier liegt, so waren sich die Gäste einig, entscheidender Reformbedarf für die nächste Ausschreibungsrunde der Exzellenzstrategie. Diese Neuausrichtung des Wissenschaftssystems sollte darüber hinaus durch eine wesentliche Maßnahme ergänzt werden: Verpflichtende und neutrale Karriereberatungen, die ehrlich und rechtzeitig alle Optionen – innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft – aufzeigen.