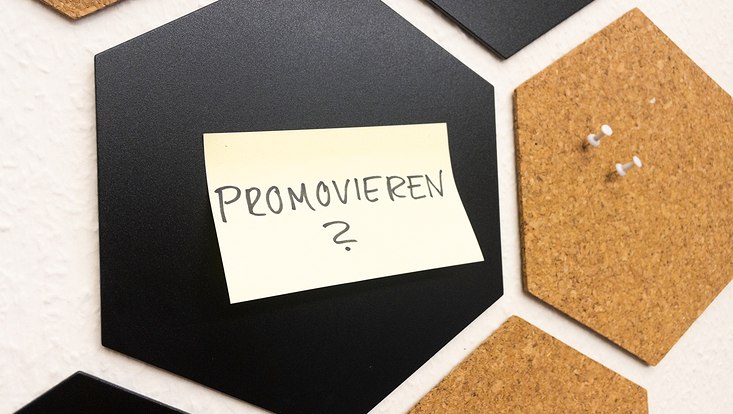Der Promovierenden-Rat der HRA bedankt sich herzlich bei Helga Nolte für das Interview sowie bei Dr. Felicitas Riedel für rechtliche Beratung und Lektorat.
Betreuungsvereinbarung als ChanceWie Konflikte im Betreuungsverhältnis vorgebeugt werden könnenGastbeitrag von Constanze Struck, Karoline Thorbecke und Lea Dohrmann aus dem Promovierenden-Rat der Hamburg Research Academy
4. Dezember 2024

Foto: UHH/Esfandiari
Die Betreuung ist ein zentrales und zugleich komplexes Grundelement von Promotionsvorhaben. Umso wichtiger ist es, die Ausgestaltung der bilateralen Beziehung zwischen Promovierenden und Betreuenden auch schriftlich zu dokumentieren. Das Ergebnis: die Betreuungsvereinbarung. Doch handelt es sich dabei um eine gelebte Form guter Betreuung oder steht „alles nur auf dem Papier”?
Was ist eine Betreuungsvereinbarung?
Zunächst einige Rahmendaten: Die Betreuungsvereinbarung ist fest im deutschen Hochschulsystem etabliert. Dabei ist das Dokument wesentlicher Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis und für dich als Promovierende*n und damit Nachwuchswissenschaftler*in wichtig. Doch was genau ist eine Betreuungsvereinbarung? Grundlegend handelt es sich hierbei um ein Schriftstück, das von beiden Seiten unterschrieben wird und wichtige zeitliche und inhaltliche Elemente des Promotionsprojektes enthält. Dies soll beiden Seiten Klarheit, Sicherheit und Orientierung geben. Dadurch stärkt eine Betreuungsvereinbarung das wechselseitige Vertrauen. Und das ist gut, denn deine Promotion wird maßgeblich dadurch bestimmt, wie vertrauensvoll das Verhältnis zwischen dir und deiner betreuenden Person ist. Um einen hohen Grad an Transparenz in Bezug auf die fachwissenschaftliche Zusammenarbeit zu erzielen, sollten in der Vereinbarung daher jegliche Absprachen und ausgelotete Bestimmungen für das Promotionsvorhaben niedergelegt werden. Dies ist direkt zu Beginn des Promotionsvorhabens sinnvoll. Doch da ein Promotionsprojekt sich entwickeln und verändern kann, empfiehlt es sich, in größeren Abständen eine Aktualisierung der Betreuungsvereinbarung vorzunehmen.
Betreuungsvereinbarungen gibt es je nach Hochschule und Fachdisziplin in diversen Formen, jedoch gilt als ein Kernelement: Es werden deine Aufgaben und Pflichten sowie die des*der Betreuenden aufgeführt. Für dich als Promovierende*n handelt es sich hierbei primär um die regelmäßige Berichtspflicht (Leistungsnachweise, absolvierte Qualifizierungsangebote et.al.) und das kontinuierliche Darlegen von neuen inhaltlichen Teilergebnissen. Auf der anderen Seite steht dir als Pflicht deines*deiner Betreuenden eine regelmäßige fachliche Begleitung zu. Die zentrale Aufgabe ist dabei die Qualitätssicherung deiner Doktorarbeit in Form von Textfeedback und Fortschrittskontrollen. Ferner geht es auch um Mentoring-Tätigkeiten und deine Einführung in die scientific community.
Wichtig sind beim Aufsetzen der Betreuungsvereinbarung vor allem die Festlegung und Näherbestimmung der regelmäßigen und langfristig angelegten Betreuungsgespräche: Welche Erwartungen haben du und deine betreuende Person in Bezug auf diese? Eine transparente Klärung dient hierbei dazu, Grundsteine für die Zusammenarbeit zu legen.
Ferner ist zu beachten, dass die Betreuungsvereinbarung nicht nur unterschiedliche Fächertraditionen, sondern auch deine individuelle Situation berücksichtigt (beispielsweise familiäre und berufliche Verpflichtungen). Ein frühes Abstecken der Regularien in Bezug auf das Betreuungsverhältnis hilft dir und euch dabei, mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen bzw. diesen prophylaktisch entgegenzuwirken. Außerdem kann die Vereinbarung auch Ausdruck und zugleich Ausgangspunkt für ein individuelles Design deines Betreuungsverhältnisses sein. Das Plädoyer hierfür lautet: „Betreuende können gemeinsam mit den Promovierenden über diese Regelungen hinaus aktiv ihre Zusammenarbeit planen und ausgestalten.”
Rechtliche Rahmenbedingungen
In aller Regel enthält die Betreuungsvereinbarung nichts, was nicht ohnehin in rechtlichen Vorschriften steht. Es ergibt sich zum Beispiel schon aus der Promotionsordnung des Fachbereichs, an dem du promovierst, was du zu leisten hast, um promoviert zu werden. Deine Betreuungsperson wiederum ist z.B. durch das Hochschulgesetz, Beamtenrecht und/oder die Ordnung der Hochschule für gute wissenschaftliche Praxis verpflichtet, dich gut zu betreuen. Die Betreuungsvereinbarung dient daher vor allem dem Zweck, die Gesamtheit aller wechselseitigen Rechte und Pflichten, die etwas verstreut in verschiedenen Gesetzen, Ordnungen usw. geregelt sind, kompakt und übersichtlich zusammen zu stellen. Das schärft das Bewusstsein. Ein Gespräch darüber zu führen, individuelle Anpassungen vorzunehmen und eine Unterschrift zu leisten, hilft dir und deiner Betreuungsperson, sich die eigene Verantwortung ins Bewusstsein zu rufen und unterstützt euch dabei, gemeinsam einen strukturierten Start ins Promotionsprojekt zu finden. Wichtige Grundlage dafür ist die Lektüre der Promotionsordnung. Wenn Beschreibungen und Pflichten in der Betreuungsvereinbarung enthalten sind, die dir überraschend, irritierend oder ungewöhnlich vorkommen, sprich das an. Dabei können dir außer der Betreuungsperson auch das Promotionsbüro, die Rechtsabteilung der Hochschule oder die Rechtsberatung des AstA helfen. Zur Orientierung verlinken wir dir auch hier noch einmal ein Beispiel für eine Betreuungsvereinbarung.
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, wenn eine Vertragspartei sich nicht an Pflichten hält?
Wenn du oder deine Betreuungsperson wesentliche Regelungen der Betreuungsvereinbarung nicht einhalten, ist das zugleich (siehe oben) ein Verstoß gegen z.B. die Promotionsordnung, das Hochschulgesetz oder die Ordnung für gute wissenschaftliche Praxis der Hochschule. Welche Folgen so eine Rechtsverletzung haben kann, steht auch in diesen Vorschriften. Um den Rechten und Pflichten eine gewisse Wirksamkeit und einen Schutz zu gewähren, gibt es im Falle schwerer Rechtsverstöße auch einschneidende Sanktionen. Als Promovierende*r riskierst du vor allem, dass das Promotionsverfahren ohne Verleihung des Doktortitels beendet bzw. abgebrochen wird. Wenn du zugleich auch eine Anstellung an der Hochschule hast, könnte auch diese gekündigt werden. Betreuungspersonen könnte die Befugnis, Promotionen zu betreuen entzogen werden oder sogar eine Entfernung aus dem Dienst drohen. Aber keine Angst: In der gelebten Realität kommen solch drastische Schritte nur äußerst selten vor. Insgesamt empfiehlt es sich immer, zunächst das Gespräch zu suchen. Wenn es im Einzelfall zu schwierig für Dich ist, deine Betreuungsperson auf das Problem anzusprechen oder ihr feststellen müsst, dass ihr in bilateralen Gesprächen keine konstruktiven Lösungen mehr findet, gibt es verschiedene Anlaufstellen zur Konfliktvermittlung. Dazu gehören die Ombudspersonen zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der Hochschule. Diese gewähren vertrauliche Beratung. Gleiches gilt auch für den Personalrat oder die Rechtsabteilung der Hochschule, der GEW und die Rechtsberatung des AStA . Oftmals sind auch Mitarbeitende im Promotionsbüro oder in Graduiertenzentren ebenfalls geschult und erfahren und führen sehr gute Beratungen durch. Du kannst zudem auch Kontakt aufnehmen mit der Geschäftsstelle der Ombudsperson bei der DFG . Alle diese Stellen können dir auch unterstützende Informationen geben, falls du den Eindruck bekommst, dass es wichtig für Dich ist, zusätzlich auch noch selbst eine Anwältin oder einen Anwalt zu beauftragen.
Unter welchen Voraussetzungen darf ein Promotionsverhältnis beendet werden
Das Promotionsverhältnis kann beendet und die Betreuungsvereinbarung aufgehoben werden, wenn es zu schweren nachhaltigen Pflicht- und Rechtsverletzungen gekommen ist. Vorher sollte es aber zunächst Kommunikation dazu geben und andere Lösungen gesucht werden. Es ist grundsätzlich auch möglich, das Promotionsverhältnis zu beenden, wenn du das erforderliche wissenschaftliche Niveau nachhaltig nicht erreichst. Voraussetzung dafür ist aber, dass du gut betreut wurdest, genügend Anleitung und Hinweise erhalten hast und nachweislich dennoch wiederholt in deinen Teilergebnissen nicht die Maßstäbe erfüllen konntest, die die Promotionsordnung anlegt. In manchen Fällen stellen auch Promovierende selbst fest, dass die Aufgabe sie überfordert. Wenn es Uneinigkeit gibt, kannst du verlangen, dass eine dritte, wissenschaftlich qualifizierte Person deinen Fortschritt und deine Erfolgsaussicht begutachtet. Aber auch hier gilt: keine Angst. So eine Konstellation tritt in der Praxis nur sehr selten auf. Wenn sich Probleme abzeichnen, ist immer noch genügend zeitlicher Spielraum, um Lösungen durch Gespräche und mit Hilfe der Anlaufstellen zu suchen (siehe oben). Wenn du gute wissenschaftliche Fortschritte machst, es aber zwischen dir und deiner Betreuungsperson aus anderen Gründen kein tragfähiges Vertrauensverhältnis mehr gibt (z.B. weil die Betreuungsperson sich dir gegenüber unangemessen verhalten hat oder nicht aktiv betreut o.Ä.), schuldet der Fachbereich bzw. die Hochschule es dir, bei einem Wechsel der Betreuungsperson zu helfen. So ein Wechsel der Betreuungsperson wird in Praxis im Fall von Konflikten der Beendigung des Promotionsverhältnisses und der (endgültigen) Aufhebung der Betreuungsvereinbarung vorgezogen und bietet eine gute Möglichkeit, ein Promotionsprojekt trotz allem zum erfolgreichen Abschluss zu führen. Daran haben die Hochschulen selbst ein Interesse, weshalb du diesbezüglich auf eine gute Unterstützung durch die oben genannten Anlaufstellen (Promotionsbüro, Ombudspersonen usw.) vertrauen kannst.
Wissenschaftliches Fehlverhalten – Wohin wende ich mich bei Konfliktfällen?
Im Idealfall schützt eine gute Betreuungsvereinbarung vor größeren Konfliktfällen im Betreuungsverhältnis. Sollte es dennoch zu Komplikationen kommen, brauchst du dich nicht scheuen, dir frühzeitig Unterstützung zu holen. Das kann durch eine Beratung in der HRA erfolgen oder – im Fall von wissenschaftlichem Fehlverhalten – bei der Ombudsstelle deiner Hochschule. Hierzu zählen beispielsweise das Ausnutzen des Abhängigkeitsverhältnissen durch die Betreuungsperson in Form von unfairen Arbeitsbedingungen oder Konflikte zur Autorenschaft oder Datennutzung. In den Ombudsstellen werden alle Anliegen streng vertraulich behandelt und es ist ebenfalls möglich, sich anonym telefonisch beraten zu lassen. Solltest du Rat benötigen oder dich in einem Konfliktfall befinden, zögere nicht, Kontakt zu einer Ombudsstelle oder Ombudsperson aufzunehmen. Am besten, bevor der Konflikt eskaliert. Darüber hinaus hast du außerdem die Möglichkeit, dich in Konfliktsituationen an die Konfliktberatung und -prävention der Hochschule zu wenden.
Sammlung Ombudspersonen der Mitgliedshochschulen
In der Regel gibt es an jeder Hochschule eine Stelle für Konfliktfälle und wissenschaftliches Fehlverhalten in Form einer Ombudsperson. Außerdem gibt es eine allgemeine, unabhängige Stelle, die für alle Wissenschaftler*innen unterstützend und beratend fungieren kann.
Für spezifischere Anliegen haben wir die Ansprechpersonen der Mitgliedshochschulen der HRA aufgelistet:
- Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)
- Universität Hamburg (UHH)
- Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
- Technische Universität Hamburg (TUHH)
- Helmut Schmidt Universität (HSU)
- Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT)
- Hochschule für bildende Künste Hamburg(HfbK)
- Bucerius Law School (BLS)
- HafenCity Universität Hamburg (HCU)
- Kühne Logistik
Interview mit Helga Nolte (Ombudsstelle Universität Hamburg)
Um dir einen tieferen Einblick in die Vorbeugung von Konfliktfällen während der Promotion zu ermöglichen, haben wir im März 2024 ein Interview mit Helga Nolte geführt. Sie ist die Leiterin der Ombudsstelle der Universität Hamburg und arbeitet als Mediatorin, systemische Coachin und Beraterin zum Thema gute wissenschaftliche Praxis. Im Interview erläutert sie häufige Anliegen von Promovierenden und gibt Hinweise für die Ausgestaltung von Betreuungsvereinbarungen.
Promovierenden-Rat: Seit wann sind Sie in der Ombudsstelle tätig und mit welchen Anliegen wenden sich Promovierende an Sie?
Helga Nolte: Die Ombudsstelle der UHH wurde im Oktober 2013 neu eingerichtet mit dem Ziel, die Ombudspersonen in ihrer Arbeit administrativ und inhaltlich zu unterstützen. Seither bin ich dort tätig. Promovierende wenden sich häufig mit folgenden Fragen bzw. Anliegen an die Ombudsstelle:
- Wem gehören eigentlich meine Ergebnisse / Daten etc.?
- Darf meine betreuende Person meine Ergebnisse ohne mein Wissen bzw. ohne mein Einverständnis an andere weitergeben?
- Darf ich Kopien meiner Ergebnisse mitnehmen, wenn ich die Einrichtung verlasse?
- Welche Regeln gelten bei der Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen?
- Wer bestimmt über Autorschaften?
- Wie definiert sich Autorschaft?
- Kann ich die Ergebnisse meiner Masterarbeit nochmal in der Dissertation verwenden?
- Darf ich meine Arbeit auch ohne das Einverständnis meiner betreuenden Person einreichen?
- Wie kann ich einen Wechsel der Betreuungsperson erreichen?
Aus Sicht der Promovierenden ist ein grundsätzliches Problem die häufig als belastend und/oder einschränkend empfundene Abhängigkeit von den Betreuungspersonen. Dies führt dazu, dass zwar z.T. gravierende Schilderungen von fragwürdiger Forschungspraxis oder Fehlverhalten gegeben werden, aber keine Bereitschaft für eine Klärung durch eine Ombudsperson besteht aus Sorge vor persönlichen Nachteilen. Auch eine unzureichende oder manchmal auch fehlende Kommunikation wird oft genannt, sodass bestehende Wissenslücken zu Fehlern und Missverständnissen führen können. Zudem werden immer wieder Fälle von konkretem Machtmissbrauch dargestellt, die zum einen natürlich Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Betreffenden haben, zum anderen auch auf die Arbeitsleistung und den erfolgreichen Abschluss des Promotionsvorhabens.
Promovierenden-Rat: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage an der Universität Hamburg zum Thema Betreuungsvereinbarungen ein?
Helga Nolte: Der Abschluss einer Betreuungsvereinbarung gehört inzwischen zu den formalen Voraussetzungen, um sich für die Promotion anmelden zu können. Damit wird aber zumeist lediglich eine Formalie erfüllt, und die Inhalte der Betreuungsvereinbarung spielen im Verlauf des Promotionsprojekts oft keine Rolle mehr.
Promovierenden-Rat: Welche Potentiale sehen Sie in Betreuungsvereinbarungen?
Helga Nolte: Eine Betreuungsvereinbarung kann ein Instrument sein, welches eine Orientierung über den gesamten Verlauf des Promotionsverfahrens geben kann. Dazu wäre es erforderlich, gegenseitige Erwartungen vorab zu besprechen, zu hinterfragen und auf ihre Realisierbarkeit zu prüfen. Die Ergebnisse können in die Betreuungsvereinbarung aufgenommen werden und regelmäßig überprüft werden, ob Änderungen bzw. Ergänzungen notwendig sind. Somit könnten Konflikte vermieden oder zumindest eine Eskalation vermieden werden.
Promovierenden-Rat: Können Sie Beispiele nennen, bei denen Konflikte durch eine Betreuungsvereinbarung hätten verhindert werden können?
Helga Nolte: Grundsätzlich kann die Klärung gegenseitiger Erwartungen und der berechtigten Anforderungen dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden. Dies gilt z.B. für Regelmäßigkeit der Feedbackgespräche, für aktive Teilnahme an Tagungen und Kongressen, aber auch für angemessene Kontrollregelungen, für Fristen für die Sichtung und Prüfung von Dissertationen, für Publikationen, für Karriereförderung etc. In der MIN-Fakultät gibt es den „individual development plan (IDP)“, der m.E. ein gutes Beispiel darstellt.
Promovierenden-Rat: Welche (hochschulpolitischen) Veränderungen halten Sie für notwendig, um die Wirksamkeit von Betreuungsvereinbarungen zu steigern?
Helga Nolte: Es erscheint mir am notwendigsten, bei den Beteiligten das Bewusstsein dahingehend zu schärfen, dass Konflikte durch präventive Maßnahmen – wie z.B. Betreuungsvereinbarungen oder IDP („individual development plan“) – vermieden oder minimiert werden können. Zudem sollte sichergestellt werden, dass nicht eine Person allein die Betreuungsfunktion wahrnehmen darf. Promotionskommissionen oder Begutachtung durch auswärtige Fachexpert*innen könnten Abhilfe schaffen. Die Verantwortlichkeit von Fakultäten (Promotionsbüro, -ausschuss und Dekanat) muss besonders in Konfliktfällen deutlicher werden – es ist nicht akzeptabel (und auch nicht durch die Forschungsfreiheit gedeckt), dass z.B. eine übermäßig lange Zeitdauer, die ein*e Professor*in für die Sichtung einer Dissertation (z.B. 9-12 Monate) benötigt, vom Promotionsbüro und -ausschuss einer Fakultät hingenommen wird, obwohl deutlich ist, dass der*dem Provierenden dadurch erhebliche Nachteile entstehen.
Promovierenden-Rat: Welche drei konkreten Ratschläge können Sie Promovierenden für die Prävention von Konflikten im Betreuungsverhältnis geben?
Helga Nolte: Grundsätzlich sollte davon ausgegangen werden können, dass der*die Promovierende sich mit der Promotionsordnung und den ergänzenden Bestimmungen vertraut gemacht hat. Auch die Satzung zur guten wissenschaftlichen Praxis sollte bekannt sein.
Meine drei Ratschläge sind:
- Ausführliches Gespräch zu Beginn der Promotionszeit führen zur Klärung von Ansprüchen und Erwartungen. Dabei sollten die Promovierenden immer auch die Perspektive und Situation der Betreuungsperson im Blick haben und bedenken, dass nicht alle Wünsche realisierbar sind.
- Unklarheiten direkt ansprechen; beginnende Konflikte ansprechen und nicht abwarten, bis sie so eskaliert sind, dass eine sachliche Kommunikation nicht mehr möglich ist. Es ist unbedingt empfehlenswert, mündlich getroffene Absprachen zu verschriftlichen und zeitnah Gesprächsnotizen anzufertigen, auch um das eigene Gedächtnis zu stützen. In gravierenden Konfliktfällen können solche Aufzeichnungen wichtig sein für die Entwicklung von Lösungen oder – im zugegebenermaßen unangenehmsten Fall – bei der Klärung der Sachlage durch Dritte, z.B. eine Ombudsperson.
- Klären, an wen man sich im Konfliktfall wenden kann, sich also frühzeitig mit den Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten der Einrichtung vertraut machen. Hier sind an erster Stelle Ombudspersonen bzw. Ombudsstelle zu nennen, aber auch Konfliktberatungsstelle, Promotionsbüro, psychologische Beratungsstelle, Antidiskriminierungsstelle o.ä. können im Konfliktfall wichtig sein. Es ist sehr hilfreich, diese Angebote zu kennen, bevor sie gebraucht werden.
Worauf solltest du bei der Vorbereitung der Betreuungsvereinbarung und im Gespräch mit deiner Betreuungsperson achten?
Eine Betreuungsvereinbarung kann dich nur dann unterstützen, wenn sie auf deine individuellen Bedarfe zugeschnitten ist. Du solltest dir also schon vor dem Gespräch mit deiner betreuenden Person Gedanken dazu machen, was dir wirklich wichtig ist und dir bei der Arbeit helfen kann. Wie häufig benötigst du Rückmeldung zu seinem Arbeitsstand? Wie sollen die Treffen ablaufen? Was erhoffst du dir von deiner betreuenden Person hinsichtlich Karriereentwicklung und wie kannst du auch deren Bedarfe erfüllen, ohne dich zu sehr einzuschränken? Über folgende Themenblöcke solltest du dir vorab Gedanken machen und sie in deine Betreuungsvereinbarung einbeziehen:
- Aufgaben und Pflichten (Promovierende und Betreuende)
- Frequenz und Ausrichtung der Treffen
- Ressourcen (Ausstattung), Finanzierung (z.B. Reisekosten für Konferenzen)
- Umgang in Konfliktfällen
- Karriereentwicklung und Einbindung in die scientific community.
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Im Gespräch zur Betreuungsvereinbarung solltet ihr euch ausreichend Zeit nehmen und gegenseitige Erwartungen und Wünsche abstecken. Indem ihr darüber sprecht, was für eine gute Zusammenarbeit nötig ist, kann Konflikten in den meisten Fällen vorgebeugt werden.
Anhaltspunkte für eine Betreuungsvereinbarung
Als Ausgangspunkt für deine eigenen Überlegungen haben wir dir Impulse und mögliche Inhalte für eine Betreuungsvereinbarung zusammengestellt. Dies kann dir als Orientierung dienen. Bitte beachte aber in jedem Fall die an deiner Fakultät geltende Promotionsordnung und sprich dich in der Gestaltung der Vereinbarung mit deiner Betreuungsperson ab.
Die HRA bietet eine Sammlung aktueller Promotionsordnungen der Mitgliedshochschulen.
Informationsmaterial
- Christina Sáez, Helga Nolte: Mentorship in research. Assuring that research integrity principals are followed in research organizations. Path2Integrity - Campaign materials #MyPath2Integrity
- Betreuung Promovierender. Empfehlungen und Good Practice für Universitäten und Betreuende. UniWiND-Publikationen Bd. 4/2014.
- QualitätsZirkel Promotion : Gemeinsam die Promotion gestalten. Handlungsempfehlungen für Betreuende, 4. Auflage 2018.
- Juraforum-Begriffsklärung „Vereinbarung“
- DFG-Betreuungsvereinbarungen
- Hamburger Hochschulgesetz, §70 Promotion
- DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft - Gute wissenschaftliche Praxis
- UHH-Ombudsangelegenheiten
- Ombudsman für die Wissenschaft
- „Schriftlich vereinbartes Vertrauen “ (Manfred Löwisch, Thomas Würtenberger)
- Hamburger Erklärung zu Hochschul-Karrierewegen in der Wissenschaft
- Glücklich Promovieren: #78 Wie du eine gute Betreuer*in auswählst
- Coachingzonen: #183 Wechsel der Promotionsbetreuung