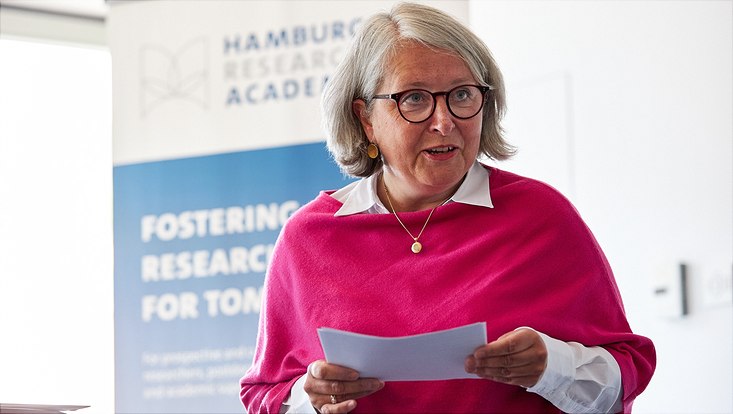„Lassen Sie uns Formate entwickeln, die Störungen und einen echten Dialog ins Zentrum rücken“
Denken Sie bei Wissenschaftskommunikation direkt an erfolgreiche und professionell produzierte Formate? In denen Forschende auf kunstvolle und eloquente Weise den Weg von der Idee über den langen, harten Weg bis hin zum Durchbruch erzählen? Dieser einseitigen Erzählweise liege oftmals eine Vorstellung von Wissenschaftskommunikation als „Paketlieferservice“ zugrunde, so Julika Griem in ihrer Keynote. In Hochglanzformaten wie den berühmten TED-Talks packe die Senderin ein Paket und möchte, dass es ohne jede Beschädigung genauso beim Empfänger eintrifft. Der Erfolg eines Kommunikationsprojekts werde demnach daran gemessen, ob die „Lieferung“ ohne Störung ankommt. Julika Griem sieht diese Beobachtung kritisch, da nicht die einseitige Performance für das Publikum, sondern vielmehr ein gemeinsamer Dialog das Ziel sein sollte. Sie forderte in ihrer Keynote daher Mut zu alternativen Formaten, die einen offenen Austausch auf Augenhöhe in den Mittelpunkt stellen und eine Störung bewusst zulassen. Gleich zu Beginn der Veranstaltung stand damit ein Plädoyer zur kritischen Reflexion des eigenen Verständnisses und der Wirkung von Wissenschaftskommunikation, was sich durch die Gespräche des restlichen Nachmittags wie ein roter Faden zog.
Karrierebremse Wissenschaftskommunikation?
Welche Auswirkungen haben die Forderungen nach mehr Wissenschaftskommunikation langfristig auf das Wissenschaftssystem und wie betreffen sie den wissenschaftlichen Nachwuchs? Ein Effekt ist, dass Forschende auch unabhängig der strengen Hierarchien im Wissenschaftssystem sichtbar werden und Wissenschaftskommunikation als Sprachrohr für ihre Arbeit nutzen können. Somit haben auch diejenigen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die Möglichkeit durch gelungene Kommunikation Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit zu lenken. Tritt man noch einen Schritt zurück und betrachtet, welche Personengruppen aktuell viel und wer kaum in der Wissenschaft kommuniziert, zeichnet sich allerdings – trotz des Vorteils der Sichtbarkeit – auch eine problematische Entwicklung ab. Während sich viele etablierte Professorinnen und Professoren eher zurückhalten, engagieren sich besonders junge Frauen in der Wissenschaftskommunikation. Was auf den ersten Blick höchstens positiv wirkt, kann weitreichende Auswirkungen haben: Wer mehr Zeit für Wissenschaftskommunikation aufwendet, hat weniger Zeit für andere Aufgaben im Forschungsalltag. Das ungleiche Generations- und Geschlechterverhältnis kann sich hierdurch in der Wissenschaft langfristig weiter verstärken. Diese gendersensible Beobachtung von Julika Griem war sehr erhellend, aber was ist die Konsequenz? Sollten arriviertere Wissenschaftler mehr kommunizieren oder Nachwuchswissenschaftlerinnen automatisch weniger? Die einzig sinnvolle Lösung scheint eine echte Anerkennung der Leistungen im Bereich Wissenschaftskommunikation. Engagement in diesem Bereich sollte keinen Nachteil, sondern einen Vorteil für den weiteren Weg in der Wissenschaft darstellen. Dies kann allerdings nur durch eine Reformation der Bewertungskriterien in Vergabeverfahren rund um Berufungen und Fördermittel erreicht werden.